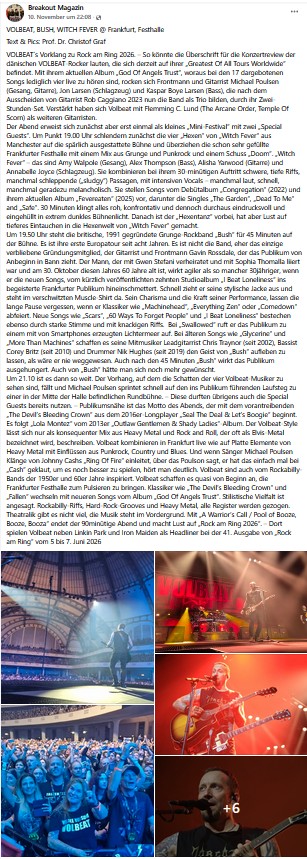Vom Arc de Triomphe zum Palais des Congrès de Paris, der Kongress- und Veranstaltungshalle im 17. Arrondissement von Paris sind die knapp zwei Kilometer zu Fuß in etwa 20 Minuten zu bewältigen oder man fährt wie am zweiten Abend mit der Metro, dann schafft man es in knapp fünf Minuten.
Noch nie bin ich bei einem Bob Dylan-Konzert zu spät gekommen, aber bei diesem. In Paris ist es einfach, die Zeit zu vergessen oder sich in Entfernungen zu täuschen. Anyway, viele Wege führen in diesem Falle nach Paris und irgendwann ist man trotz aller „rough and rowdy ways“ dort, wo man sein möchte. So elegant und „pariserisch“ die Bezeichnung „Palais des Congrès de Paris“ auch klingt, der Palais ist es nicht. Nach drei Brüsseler Abenden in einem belgischen klassischen und in der Tat außen und innen elegant wirkenden „Bozar“ wirkt das sogenannte „große Amphitheater“ (Grande amphithéâtre) mit 3.723 Sitzplätzen eher nüchtern, wie eine Kongresshalle eben. Beide Abende sind nahezu ausverkauft. Kommt man mit der Metro an, führen die Treppenaufgänge direkt ins Foyer. Kommt man zu Fuß auf die Halle zu, wirkt die Location wie eine dieser typischen Kongresshallen aus den 1970er Jahren. Unspektakulär aber funktional. Nüchtern. Kein Plakat macht darauf aufmerksam, dass hier zwei Tage eine Legende Kunstwerke aufführt. Die angekündigten Kontrollen der Smartphones laufen recht moderat ab. Die Halle wirkt, als könne sie mehr als diese 3723 Sitzplätze anbieten. Als sie um Punkt 20.00 Uhr abgedunkelt wird, erscheinen fünf Musiker auf der danach nicht viel helleren Bühne. Einer davon ist Bob Dylan, die anderen gehören zu seiner derzeitigen „Rough And Rowdy Ways“-Tourband. Was folgt ist mit dem Satz “Same procedure as every year“ aus “Diner For One” zu beschreiben: “Same procedure as every concert this year“. Es gibt keine Veränderung der Setlist gegenüber den letzten diesjährigen Herbst-Konzerten. Dylan „versteckt“ sich hinter seinem Klavier. Er spielt als Einführung mal wieder sitzend, mit dem Rücken zum Publikum jeweils die ersten zwei Minuten der ersten beiden Songs „I’ll Be Your Baby Tonight“ und „It Ain’t Me, Babe“ mit der auf einem Hocker bereitliegenden E-Gitarre. Richtig sehen tun das nur wenige. Wissen tun das diejenigen, die schon RARW-Shows zuvor gesehen haben.
Viel zu sehen gibt es vom Meister seit diesem Sommer kaum noch. Es gibt gar geradezu kaum eine Chance auch nur einen Blick auf den Maestro werfen zu können. Für jene, die das schon von ihm kennen, ist das zwar keine Überraschung aber immer noch Enttäuschung. Für jene, die das zum ersten Mal erleben, ist es Enttäuschung pur. Wer teure Tickets in den ersten Reihen kauft, sieht von Dylan nichts. Die ersten beiden Songs wirken polternd. Sie sind noch etwas unausgesteuert. Um „Dylan live in concert 2025“ dylanesque zu erleben, muss man sich einen neuen eigenen Ansatz suchen. Einige verzichten darauf und verlassen schon nach dem ersten Drittel den Saal. Andere verlassen den Saal für einige Songs, um sich ein Getränk zu genehmigen. Getränke in der Halle sind nicht erlaubt. Wenn sie zurückkommen haben sie showmäßig nichts verpasst. Für sie muss es wirken, als würden sie das Konzert dort weitersehen, wo sie die „Pause-Taste“ gedrückt hatten. Musikmäßig haben sie jedoch wahre Songperlen verpasst, wie z.B. „Crossing The Rubicon“, das Dylan mit Klavierpassagen verziert oder wie z.B. das wie ein „Rap“ an diesem Abend klingende „My Own Version Of You“.
Wenn man weiter oben auf den Rängen sitzt, ist das Kommen und Gehen gut zu beobachten. Die, die als Zeitzeuge von Dylans Entstehen seines musikalischen Gemäldes beiwohnen möchten, stört das Aufstehen müssen. Man kann sogar auf Entfernung vermuten, wie sie Grimassen ziehen, wenn sie aus ihrer Andacht gerissen werden, um jemand fürs Pinkeln oder Biertrinken vorbeizulassen. – 100 Minuten Dylan sind heilig. Da darf nicht gestört werden.
Die 17 Songs in Paris I offerieren ungeachtet der nicht optimalen Akustik einige Songperlen. Die eine glänzt jedoch etwas mehr als die andere. Perlen sind es schließlich alle, auch wenn Bob Dylan an diesem ersten Pariser Abend nicht alle zum Glänzen bringen konnte. Vielleicht war er müde, vielleicht nicht konzentriert. Einige Songzeilen vernuschelte er schon beim dritten Song, „I Contain Multitudes“. Einige weitere vernuschelt gleich danach in „False Prohet“. Dem Zusammenspiel mit der wiederum sehr gut aufeinander abgestimmten Band an diesem Abend tut das keinen Abbruch. Die Band „bügelt“ über das „Nuscheln“ drüber. Bei „Black Rider“ klingt das Echo etwas zu hart.
Die erste wahre Songperle in Paris 2025 ist „When I paint My masterpiece”. Selten erlebte ich diesen Song bei meinen bis dahin 19. RARW-Konzerten, derart intim vorgetragen. Dylan inszeniert dieses Lied nicht, er zelebriert es. Er wirft mit seinen Worten Bilder auf eine imaginäre Leinwand in den Köpfen seiner Zuhörer.
Sehen, wer sie singt, tun die Zuhörer sowieso nicht. Viel ist im statisch dunklen Gelb ohne jegliche Schattierungen nicht zu sehen. Zu erkennen sind eigentlich nur stoisch wirkende Schatten, die sich wie in Zeitlupe um den Mann am Klavier dezent bewegen. Vielmehr als Dylans angestrahlter Kopf, der wie das Plattencover der „Greatest Hits Volume 3“ wirkt, ist vom Maestro nicht zu sehen.
Die Bühne wirkt durch die Reduktion des Lichtdesigns kleiner in dieser großen nüchternen Halle, als sie es tatsächlich ist. Mehr Licht gibt es nicht. Selbst an den drei Tagen zuvor im Bozar war es heller und atmosphärisch dichter. In Paris herrschte Dunkelheit. Ebenso wie es keine Lösungsmuster für die Interpretation seiner Texte gibt, ebenso gibt es kein Licht. In all dem Dunkel klingen die eigenen Gedanken beim Zuhören umso „heller“ nach. Ich habe den Eindruck Dylan tritt gerade bei „When I Paint My Masterpiece“ mit dem Publikum in Dialog. Er greift zur Mundharmonika, was die Pariser mit spontanem Applaus goutieren. Später tut er das bei „Desolation Row“ und bei „Very Grain Of Sand“ (also immer bei den älteren Songs) noch einmal. Mit dem Publikum spricht Dylan nicht, weder zu Beginn, währenddessen noch am Ende. Wenn er zur Mundharmonika greift, wirkt das fast wie eine Art „Ersatz-Kommunikation“ mit dem Publikum, das dies sofort mit spontanem Applaus dankend quittiert. Aber zurück zum „Masterpiece“. Beim genauen Hinhören, verstehe ich fast jeden Satz. Dylans Stimme ist bis auf gelegentliches Nuscheln stark, durchdringend und dennoch immer etwas nasal. Beim „Masterpiece“ ist die Stimme glasklar und im Kongresssaal herrscht dabei andächtige Stille. Worte wie „Someday, everything is gonna be smooth like a rhapsody/ When I paint my masterpiece” klingen nach. “Someday, everything is gonna be different/ When I paint my masterpiece” wirken, als würde er mit einem Pinsel seine Worte auf eine Leinwand klatschen. Der Betrachter darf dann quasi zeitgleich in dem daraus entstandenen Bild sehen, was er möchte. Je mehr Dylan-Konzerte ich besuche, umso mehr mache ich mir über die gehörten Lieder Gedanken. Ich lasse sie nachklingen. Die Lieder bekommen von Mal zu Mal eine neue Tiefe, eine Güte, gar eine neue Bedeutung, als ich ihnen irgendwann mal zuvor zugeschrieben hatte oder aber sie behalten ihre alte Bedeutung, quasi als eine Art Bestätigung und Zustimmung für das, was man dem Lied einmal zuschrieben hat. „Masterpiece“ thematisiert schon immer die Unsicherheit und das Streben nach einem idealen Zustand, der alles Negative hinter sich lassen könnte, auch wenn es eine nie endende Suche ist. Dylan beschrieb diesen „idealen Zustand“ einmal als einen Ort „jenseits der eigenen Erfahrung, der so überragend ist, dass man ihn nicht mehr verlassen möchte.“ – Alte Bedeutung, neue Tiefe aus meiner Sicht der Dinge. – An diesem Abend, liegt dieser Ort zumindest für einen Song lang in Paris. Nirgendwo sonst, habe ich Dylans „Wunsch nach Vollendung“, seine Sehnsucht, ein Meisterwerk zu erschaffen, das die eigene Unsicherheit und bisherige Arbeit abschließt intensiver wahrgenommen als in Paris I. „Masterpiece“ wird zur Einladung in Dylans musikalische Vernissage voller leerer Leinwände. Er groont ein wenig, singt oder spricht die meiste Zeit seine Texte zu Blues, Folk, Country, Latin und Jazz. Sein eigenes Antlitz entzieht er den Blicken. Irgendwie kommt es mir vor, als will er mit den langsamen letzten Liedern „I`ve Made Up My Mind To Give Myself To You“ und „Mother Of Muses“ seine letzten Gemälde des ersten Pariser Abends präsentieren. Mit dem rock`n`roll-haften „Goodbye Jimmy Reed“ wird es laut und schnell. Der „scheppernde“ Sound passt gut zur Nüchternheit des Saales. Zeichen seiner Vielfalt. – Seit Beginn seiner Karriere versuchte er aus dem Schatten zu treten. Am Ende seiner Karriere tritt er wieder dorthin zurück. Ein paar Momente nach dem letzten Song „Every Grain Of Sand“ steht er vom Klavierhocker auf, geht langsamen Schrittes zur Bühnenmitte, winkt seine Band zu sich und schaut stillschweigend ins jubelnde Publikum. Eine letzte Chance, die Legende für 20 Sekunden schließlich doch noch im Licht der nun für kurze Zeit erhellten Bühne zu sehen. Neben dem Harmonikaspiel und dem Präsentieren seiner imaginären Leinwände ist das die dritte Form und an diesem Abend auch die letzte, mit der er mit dem Publikum „kommuniziert“. – Ich freue mich auf eine weitere Nacht in Paris.